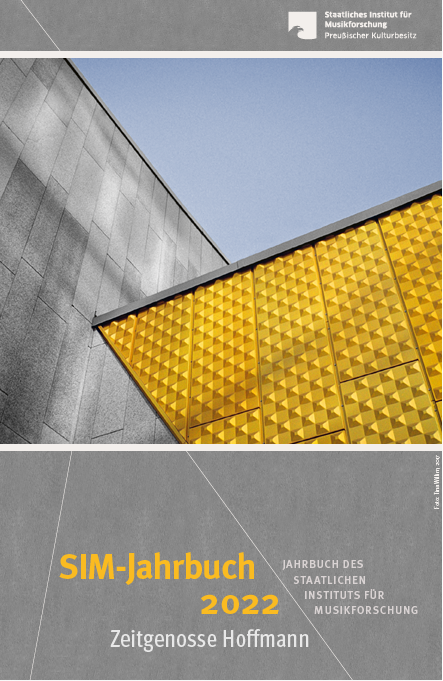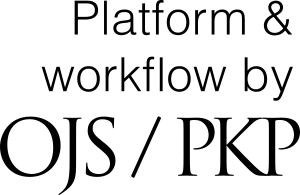Musica Sine Anima
Fear and Attraction towards the Musical Automata in the Churches of 20th-Century Italy
DOI:
https://doi.org/10.71046/simjb.2022.32Schlagworte:
Catholic liturgy, Cecilian movement, sacred music, mechanical music, E. T. A. Hoffmann, auto-organAbstract
Musica Sine Anima. Fear and Attraction towards the Musical Automata in the Churches of 20th-Century Italy
This article examines the intersection of music, technology, and liturgical practice through the case of Angelo Barbieri’s auto-organ, an automatic organ introduced to Italian churches in 1931. Its emergence is situated within a longer intellectual and ecclesiastical trajectory beginning with Romantic aesthetics, particularly E. T. A. Hoffmann’s reflections on the spiritual nature of music and its incompatibility with mechanical reproduction. These ideas shaped the Cecilian movement of the 19th century and influenced Pope Pius X’s 1903 Motu Proprio »Tra le sollecitudini«, which prohibited the use of mechanical instruments in the liturgy. Against this backdrop, Barbieri’s invention, designed to address the shortage of organists in parish churches, provoked debate regarding the legitimacy of machine-produced sacred music. Contemporary responses ranged from rejection of the auto-organ as a soulless device undermining the spiritual essence of worship, to support for its practical advantages, particularly in under-resourced parishes. Drawing on theological texts, ecclesiastical decrees, contemporary journals, and archival materials, this study argues that the controversy surrounding the auto-organ exemplifies broader tensions between tradition and innovation, authenticity and reproducibility, in modern sacred music. The case illustrates how the Catholic Church negotiated the challenges posed by mechanical music, simultaneously resisting and appropriating technology, and thus provides insight into shifting conceptions of liturgical art in the 20th century.
Musica Sine Anima. Furcht und Anziehungskraft der Musikautomaten in den Kirchen des 20. Jahrhunderts in Italien
In diesem Artikel wird der Schnittpunkt von Musik, Technologie und liturgischer Praxis am Beispiel der auto-organo von Angelo Barbieri untersucht, einer automatischen Orgel, die 1931 in italienischen Kirchen eingeführt wurde. Ihre Entstehung ist in eine längere intellektuelle und kirchliche Entwicklung eingebettet, die mit der romantischen Ästhetik beginnt, insbesondere mit E. T. A. Hoffmanns Überlegungen zur spirituellen Natur der Musik und ihrer Unvereinbarkeit mit mechanischer Reproduktion. Diese Ideen prägten den Caecilianismus im 19. Jahrhundert und beeinflussten das Motu Proprio »Tra le sollecitudini« von Papst Pius X. aus dem Jahr 1903, das die Verwendung mechanischer Instrumente in der Liturgie untersagte. Vor diesem Hintergrund löste Barbieris Erfindung, mit der dem Mangel an Organisten in den Pfarrkirchen begegnet werden sollte, eine Debatte über die Legitimität maschinell erzeugter Kirchenmusik aus. Die zeitgenössischen Reaktionen reichten von der Ablehnung der automatischen Orgel als seelenloses Gerät, das die spirituelle Essenz des Gottesdienstes untergräbt, bis hin zur Befürwortung wegen ihrer praktischen Vorteile, insbesondere in unterfinanzierten Kirchengemeinden. Anhand von theologischen Texten, kirchlichen Erlassen, zeitgenössischen Zeitschriften und Archivmaterial zeigt diese Studie, dass die Kontroverse um die automatische Orgel beispielhaft für das Spannungsfeld zwischen Tradition und Innovation, Authentizität und Reproduzierbarkeit in der modernen Kirchenmusik ist. Der Fall veranschaulicht, wie die katholische Kirche mit den Herausforderungen der mechanischen Musik umging, indem sie sich gleichzeitig gegen die Technologie wehrte und sich diese aneignete, und bietet somit einen Einblick in die sich verändernden Vorstellungen von liturgischer Kunst im 20. Jahrhundert.
Downloads
Veröffentlicht
Zitationsvorschlag
Ausgabe
Rubrik
Lizenz
Copyright (c) 2025 Elena Borelli, Giorgio Farabegoli

Dieses Werk steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0 International.